
Die Zeitschrift Brandeins hat sich kürzlich unter dem Aufmacher „Verklemm Dich nicht“ wieder einmal mit der Genderfrage in Unternehmen und Organisationen beschäftigt. Das Ganze wirkte sogar etwas mürrisch, so als ob man sich „immer noch“ damit beschäftigen muss.
Wieder sind viele tolle Beispiele erfolgreicher Frauen dargestellt. Warum ist das nicht durchgehend der Fall? Sind es pure Machtattitüden der Männer oder etwas ganz geheimnisvolles, dass hier verantwortlich gezeichnet wird? Aber da ist überhaupt nichts ominöses, tiefenpsychologisches, was die Frauen in eine schlechtere Position geraten lässt. Warum nicht?
Es liegt an einer aufgrund der Sozialisation von Frauen -Gott sei Dank- vorhandenen stärkeren sozialen und menschlichen Orientierung. Männer, die sozial eingestellt sind und hohe Empathie zeigen, haben die gleichen Nachteile wie Frauen in der Wirtschaft und anderen Organisationen. Allenfalls im "menschelnden" Personalbereich dürfen Frauen ran.
Denn die Logik der Wirtschaft bezieht sich hauptsächlich auf das Konkurrenz-Denken und die Haltung "sich gegeneinander Vorteile zu verschaffen". Es ist weiter die Kampflogik vorhanden. Neuere Ansätze der Gemeinwohlökonomie (Felber, 2009; Mohr, 2015), in denen kooperative Strukturen auch aus ökonomischen Gründen beispielsweise der Reduzierung von Verschwendung empfohlen werden, sind bisher zarte Pflänzchen. Nun ist es nicht so, dass Frauen nicht kämpfen können oder wollen, aber sie haben darin in der Regel weniger Training als Männer.
Es kommt aber noch ein entscheidender weiterer Punkt hinzu: Die Wirtschaft ist ausgeprägt hierarchisch. Der wohl bekannteste Anbieter von Managementtrainings in Europa bewirbt seinen General Management-Lehrgang immer noch folgendermaßen:
„Die strategische Gesamtführung ist zudem immer Chefsache, nicht delegierbar, egal, ob aufkommende Probleme markt- oder hausbedingt. Die vorbereitende Ausarbeitung von Analysen, Strategie-Entwürfen und Plänen ist zwar an nachgelagerte Führungsebenen delegierbar. Nicht so jedoch die Beurteilung der Ausgangslage, das Erkennen des Handlungsbedarfs sowie die zentralen Entscheidungen über die Zukunft des Unternehmens. Gesamtverantwortliche Führungskräfte kommen nicht umhin, ihre „Leitplanken-Verantwortung“ wahrzunehmen.“
Diese Beschreibung offenbart ein Bild des Zusammenwirkens der Menschen im Unternehmen, das sich vom alten "Gutsherrenmodell" im Prinzip noch nicht unterscheidet. Davon einmal abgesehen, dass dies gar nicht funktioniert und Lichtgestalten unterstellt, die es gar nicht gibt, setzt es aber seit Generationen Manager unter ein Erwartungsbild, das nur die lösen können, die es gar nicht annehmen, sondern insgeheim partizipative Entscheidungen aufgrund der Wertschätzung ihrer Mitarbeiter leben. Das heißt, hinter der "Genderfrage" steht eigentlich ein altes mentales Modell: nämlich die immer noch verbreitete Erwartung an Funktionsträger, durch geringe Empathiewerte und ein hierarchisches Steuerungsbild in Wirtschaft und Unternehmen charakterisiert sind.
In meinem Buch thematisiere ich dieses alte Wirtschaftsmodell und gehe auf die Psycho-Logik der Wirtschaft genauer ein: Mohr, G. (2015): Systemische Wirtschaftsanalyse, Bergisch-Gladbach: EHP
> hier erhältlich
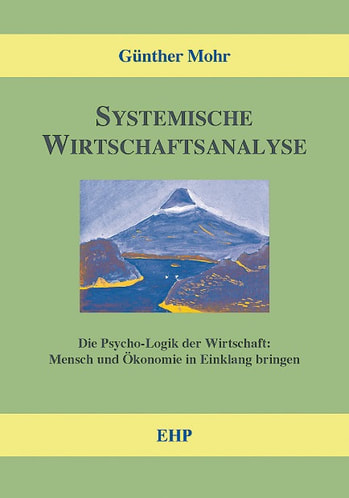


 RSS-Feed
RSS-Feed
